Finanzierung der Unterbringung von Fluchtwaisen

Die finanziellen Ressourcen, die den Betreuungseinrichtungen für unbegleitete Kinderflüchtlinge von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden, sind weit unter jenen, die im Rahmen der Kinder- und Jungendhilfe fremduntergebrachten Kinder liegen. Eine altersgerechte Betreuung ist ohne zusätzliche Spendengelder kaum möglich. Die lang erkämpfte Erhöhung der Tagsätze für Fluchtwaisen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Sie muss aber noch umgesetzt werden.
Wenn unbegleitete Kinderflüchtlinge einen Asylantrag stellen, werden sie zunächst in sogenannten Bundesbetreuungseinrichtungen der BBU untergebracht. In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um Großquartiere ohne adäquate Betreuungsmöglichkeiten – etwa jene in Traiskirchen, in denen die Kinder zwar im wahrsten Sinne des Wortes grundversorgt sind und ihnen Rechtsberater:innen der BBU im Asylverfahren Unterstützung geben, aber niemand die Obsorge innehat – also niemand die Verantwortung für ihre Pflege und Erziehung übernimmt und auch niemand für alle anderen Rechtsgebiete außerhalb des Asylverfahrens sie unterstützt und vertritt. Niemand darf Entscheidungen etwa über die Schule oder bei medizinischen Notfällen im Krankenhaus treffen. Aus Mangel an Betreuungsstellen in den Bundesländern bleiben die Kinder oft weit über die Dauer des Zulassungsverfahrens hinaus in Einrichtungen des Bundes und damit ohne Obsorge.
Im weiteren Verlauf des Asylverfahrens werden die Kinder dann – sofern verfügbar – in kleinere Betreuungseinrichtungen der Bundesländer zugewiesen, wobei die Art der Unterbringung in erster Linie von ihrem Alter abhängt: Während unmündige Minderjährige bis 14 Jahre in kleinteiligen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden können (aber nicht müssen), werden mündige Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren automatisch in Wohngruppen der Grundversorgung untergebracht und damit verwaltungstechnisch wie Erwachsene behandelt. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben in der Regel eine bessere Finanzierung und einen besseren Betreuungsschlüssel, wodurch eine bessere und altersgerechtere Unterstützung der Kinder gewährleistet werden kann. Mit der Zuteilung in ein Bundesland geht die Obsorge für die Fluchtwaisen an die Kinder- und Jugendhilfe über.
Die Finanzierung der Betreuungseinrichtungen für alle Fluchtwaisen ist zunächst in der Grundversorgungsvereinbarung Art. 15a B-VG festgelegt. Diese 15a-Vereinbarung regelt genau, zu welchen Teilen jeweils Bund und Länder die Kosten für die Grundversorgung tragen und sie enthält auch die Höhe der durch Verhandlungen vereinbarten Tagsätze, die an die Betreuungseinrichtungen bezahlt werden – also der Betrag der pro Schutzsuchenden an die Einrichtung pro Tag bezahlt wird. Sie wird im Nationalrat beschlossen (erstmals 2004) und muss dann von den Bundesländern, die hier einen gewissen Spielraum haben, umgesetzt werden. So schöpfen zum Beispiel nicht alle Bundesländer die Tagsätze, die als Kostenhöchstsätze zu verstehen sind, in voller Höhe aus.

Im Juli 2024 wurde die lang erkämpfte Erhöhung der Tagsätze im Nationalrat beschlossen. Laut Grundversorgungsänderungsvereinbarung gibt es nun nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Betreuungskategorien, gleichzeitig werden neue Kostenhöchstsätze festgelegt, die rückwirkend ab Jänner 2024 pro Kind und Tag verrechnet werden können:
Unklar bleibt, ob Betreuungseinrichtungen in die erste oder in die zweite Kategorie fallen. Dies wird sich erst im Laufe der Verhandlungen in den einzelnen Bundesländern zeigen. Darüber hinaus sind in manchen Bundesländern besondere Regelungen zu berücksichtigen: So ist zum Beispiel in Oberösterreich die Rechtsvertretung bereits im Tagsatz enthalten, sodass die Betreuungsstellen selbst für die Finanzierung sorgen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob die oberösterreichische Praxis beibehalten wird oder ob eine Angleichung an andere Bundesländer erfolgt.
Sowohl die bisherigen als auch die neuen Höchstsätze bieten den Rahmen, innerhalb dessen die Bundesländer ihre Tagsätze festlegen können, es steht den Bundesländern frei, ob sie diesen Rahmen zur Gänze ausschöpfen oder ob sie niedrigere Kostensätze festsetzen. Dies muss nun noch in den Landtagen beschlossen werden, bevor die neuen Tagsätze an die Betreuungseinrichtungen ausgezahlt werden können. Es ist leider zu befürchten, dass nicht alle Bundesländer die entsprechenden Beschlüsse noch im Jahr 2024 fassen und umsetzen. In manchen Bundesländern besteht sogar das Risiko, dass die neuen Höchstsätze gar nicht zur Umsetzung kommen.
Im weiteren Verlauf des Asylverfahrens werden die Kinder dann – sofern verfügbar – in kleinere Betreuungseinrichtungen der Bundesländer zugewiesen, wobei die Art der Unterbringung in erster Linie von ihrem Alter abhängt: Während unmündige Minderjährige bis 14 Jahre in kleinteiligen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden können (aber nicht müssen), werden mündige Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren automatisch in Wohngruppen der Grundversorgung untergebracht und damit verwaltungstechnisch wie Erwachsene behandelt. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben in der Regel eine bessere Finanzierung und einen besseren Betreuungsschlüssel, wodurch eine bessere und altersgerechtere Unterstützung der Kinder gewährleistet werden kann. Mit der Zuteilung in ein Bundesland geht die Obsorge für die Fluchtwaisen an die Kinder- und Jugendhilfe über.
Die Finanzierung der Betreuungseinrichtungen für alle Fluchtwaisen ist zunächst in der Grundversorgungsvereinbarung Art. 15a B-VG festgelegt. Diese 15a-Vereinbarung regelt genau, zu welchen Teilen jeweils Bund und Länder die Kosten für die Grundversorgung tragen und sie enthält auch die Höhe der durch Verhandlungen vereinbarten Tagsätze, die an die Betreuungseinrichtungen bezahlt werden – also der Betrag der pro Schutzsuchenden an die Einrichtung pro Tag bezahlt wird. Sie wird im Nationalrat beschlossen (erstmals 2004) und muss dann von den Bundesländern, die hier einen gewissen Spielraum haben, umgesetzt werden. So schöpfen zum Beispiel nicht alle Bundesländer die Tagsätze, die als Kostenhöchstsätze zu verstehen sind, in voller Höhe aus.
Erhöhung der Tagsätze rückwirkend ab Jänner 2024
Bis Juli 2024 galten österreichweit für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen folgende Betreuungskategorien und Tagsätze (Beträge pro Kind und Tag):- Wohngruppe: 1:10 = 1 Betreuer:in für 10 Kinder, Tagsatz 95,00 Euro
- Wohnheim: 1:15 = 1 Betreuer:in für 15 Kinder, Tagsatz 63,50 Euro
- betreutes Wohnen: 1:20 = 1 Betreuer:in für 20 Kinder, Tagsatz 40,50 Euro

Im Juli 2024 wurde die lang erkämpfte Erhöhung der Tagsätze im Nationalrat beschlossen. Laut Grundversorgungsänderungsvereinbarung gibt es nun nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Betreuungskategorien, gleichzeitig werden neue Kostenhöchstsätze festgelegt, die rückwirkend ab Jänner 2024 pro Kind und Tag verrechnet werden können:
- Unterbringung, Verpflegung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger - Tagsatz 112,00 Euro
- Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen in Einrichtungen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe - Tagsatz 130,00 Euro
Unklar bleibt, ob Betreuungseinrichtungen in die erste oder in die zweite Kategorie fallen. Dies wird sich erst im Laufe der Verhandlungen in den einzelnen Bundesländern zeigen. Darüber hinaus sind in manchen Bundesländern besondere Regelungen zu berücksichtigen: So ist zum Beispiel in Oberösterreich die Rechtsvertretung bereits im Tagsatz enthalten, sodass die Betreuungsstellen selbst für die Finanzierung sorgen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob die oberösterreichische Praxis beibehalten wird oder ob eine Angleichung an andere Bundesländer erfolgt.
Sowohl die bisherigen als auch die neuen Höchstsätze bieten den Rahmen, innerhalb dessen die Bundesländer ihre Tagsätze festlegen können, es steht den Bundesländern frei, ob sie diesen Rahmen zur Gänze ausschöpfen oder ob sie niedrigere Kostensätze festsetzen. Dies muss nun noch in den Landtagen beschlossen werden, bevor die neuen Tagsätze an die Betreuungseinrichtungen ausgezahlt werden können. Es ist leider zu befürchten, dass nicht alle Bundesländer die entsprechenden Beschlüsse noch im Jahr 2024 fassen und umsetzen. In manchen Bundesländern besteht sogar das Risiko, dass die neuen Höchstsätze gar nicht zur Umsetzung kommen.



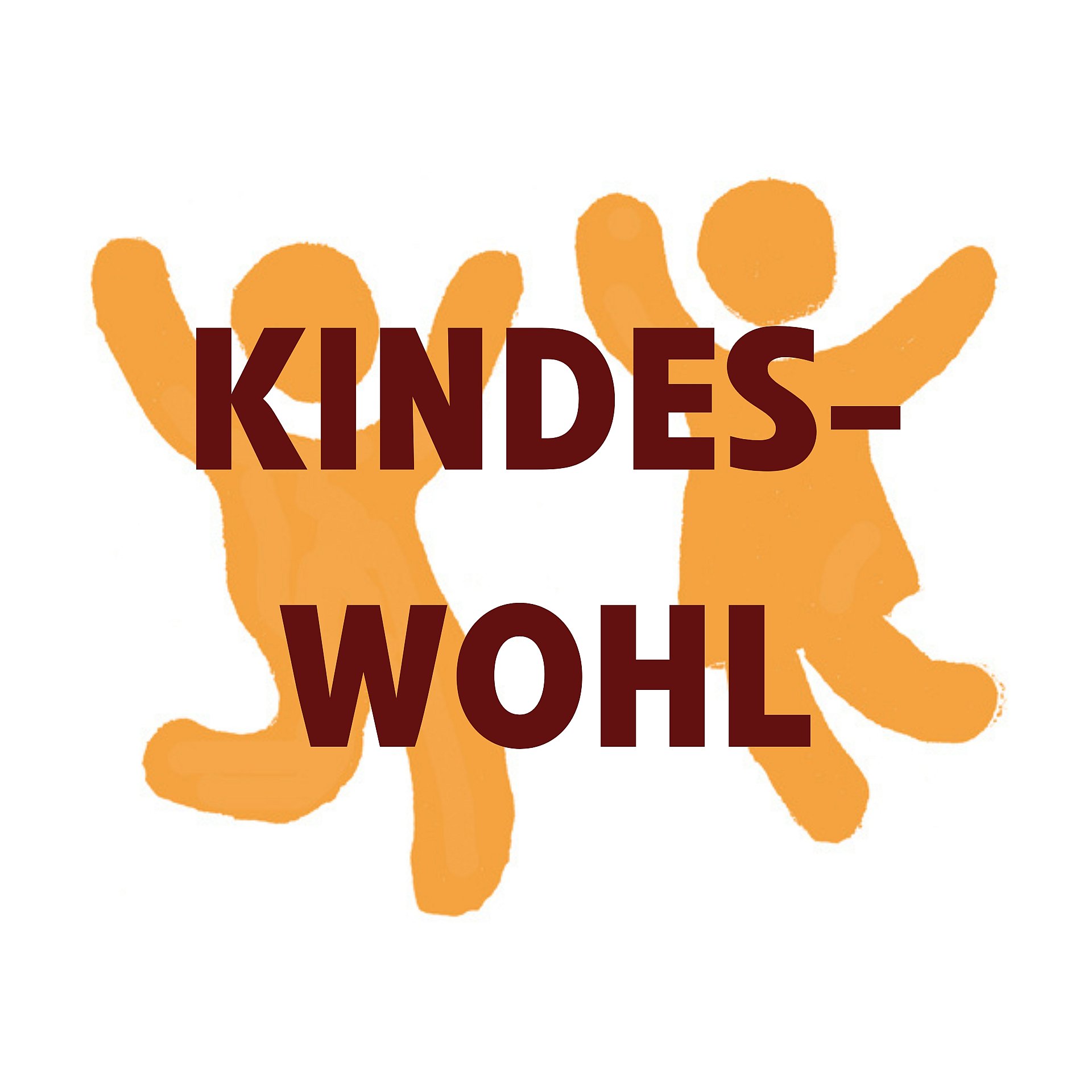






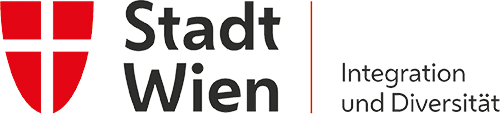




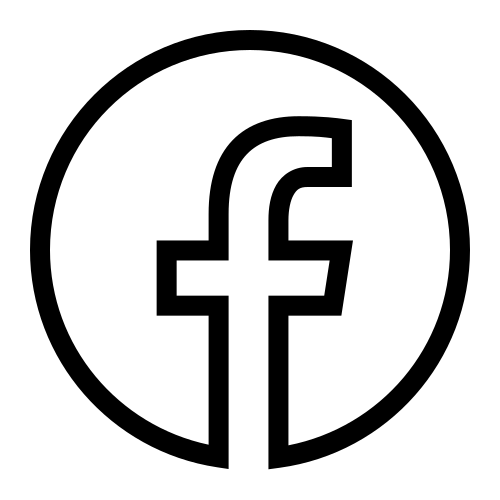
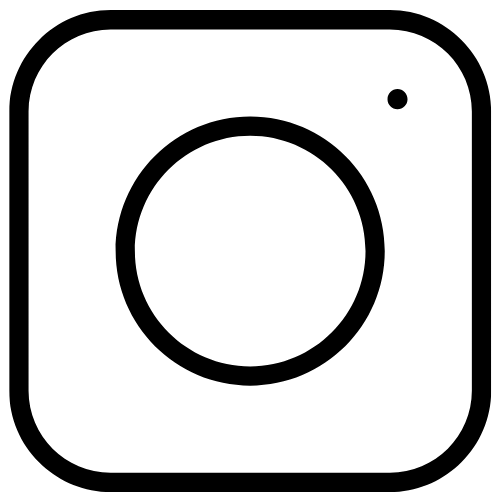
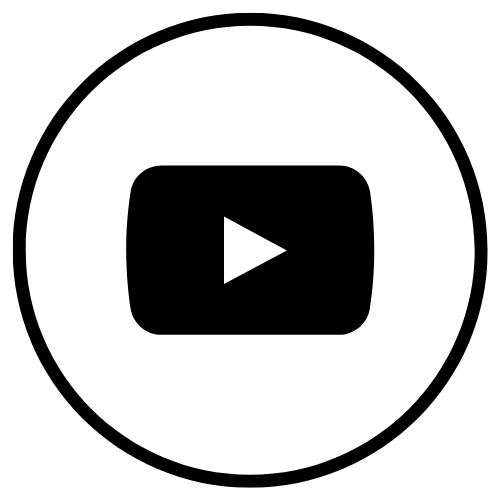
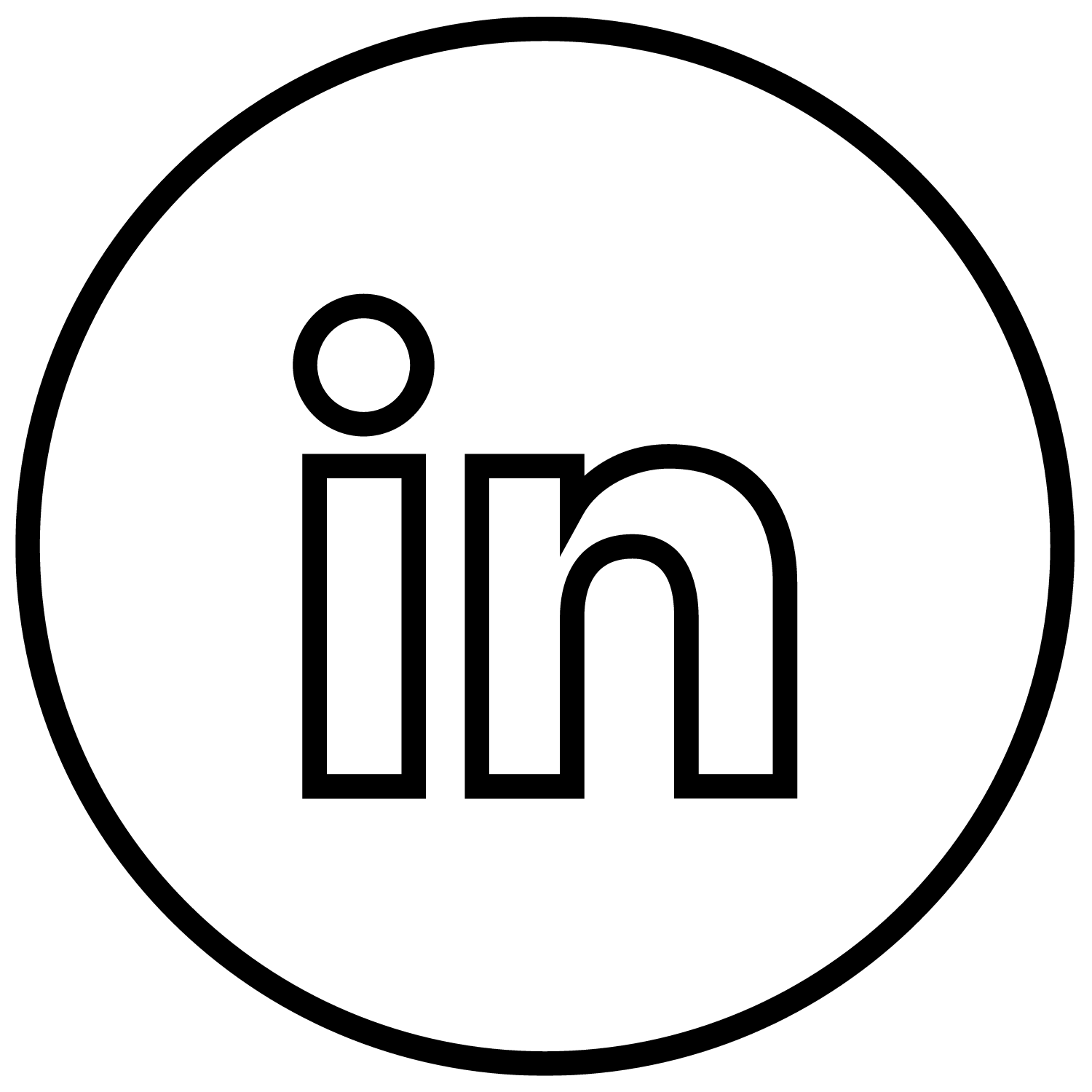
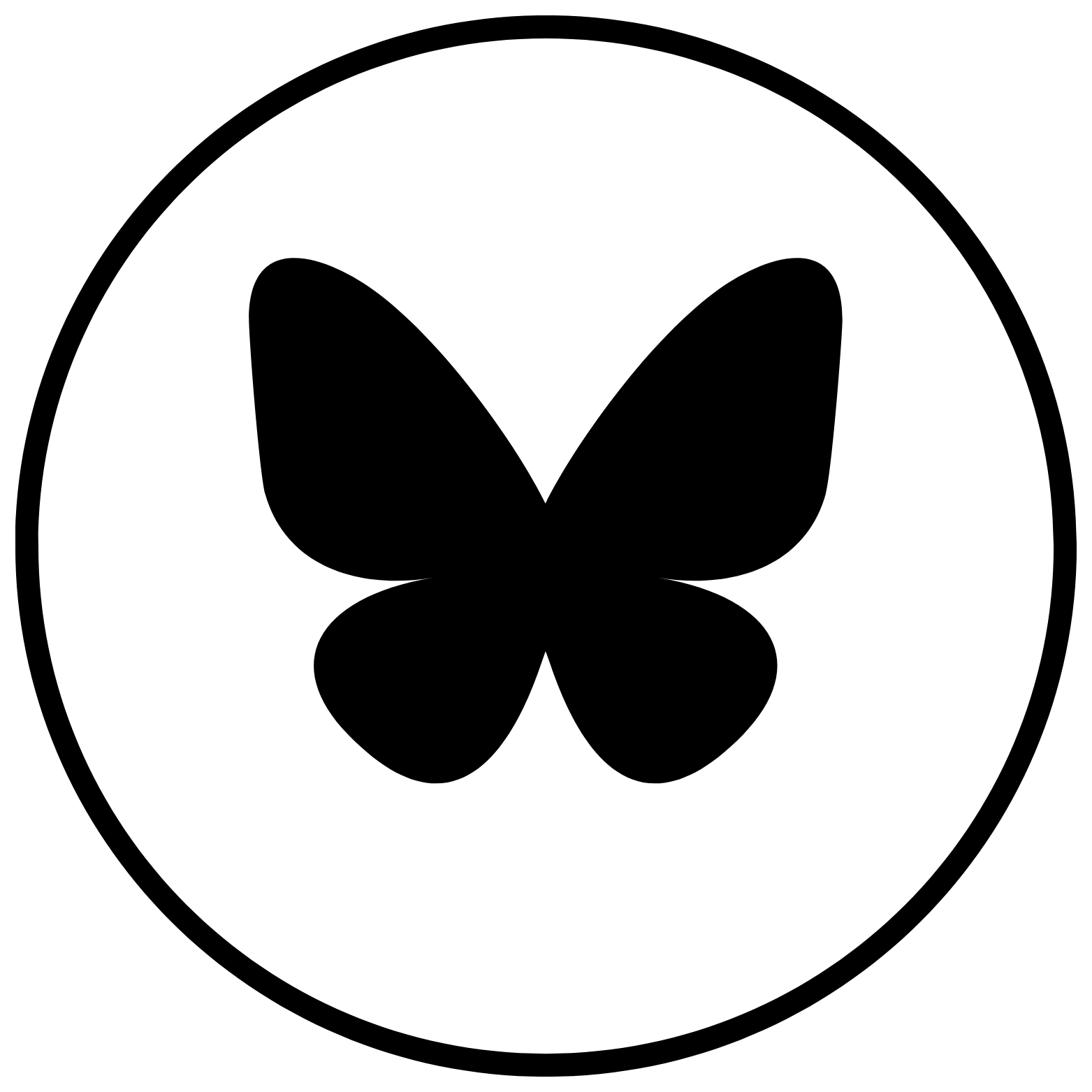
 Bequem spenden -
Bequem spenden -